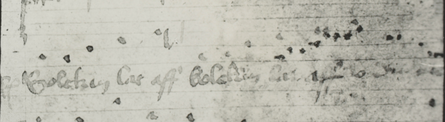"Woldestu yo min boleken wezen?"
Textinformationen
Nummer im RLB: 37 (Claussen: 31)
Blattnummer: 29v–30r; Notation der Melodie auf Bl. 44r
Texttyp: Register IV – Tanzlied (1.3.4)
Inhalt: Tanzlied: Ein lateinischer Nachsatz verdeutlicht, wie das Lied vorgetragen werden soll. Ein Mann bittet eine Dame um ihre Zuneigung und bietet ihr dafür ein Geschenk an (Holzschuhe, die "klyppeken"). Nachdem sie beides ablehnt, raten die Zuhörer in einem Refrain dem Werber, es nicht noch einmal bei ihr zu versuchen, worauf sich ein anderer mit einem Geschenk an die Dame wendet.
Textabdruck
Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 255 [63]f.
Item.
Woldeſtu yo min boleken wezen?
ik wolde dick en par klyppeken gheuen:
wo behaghet dy dat?
"Dat du mik en par klyppeken gheueſt
vnd ik des dy nenen danck en wuſte,
wat vor ſloghe dy dat?
Bolekyn lat aff.
yo du mer [nu l[.]cht, yo du mer verloren hefft, bolek[in]],
dat helpet dy nicht en kaff."
Finge hic plures verſus ſecundum iſtos
primos duos verſus, niſi quod mutabis
rem (et nomen ipſius) quam dare vis mulieri.
Woldeſtu yo min boleken weſen,
ik wolde di en p[ar] klypken gheuen,
wo behaghet di dat?
Bolekin lat aff,
bolekin lat aff.
io du mer nu lecht,
io du mer vorloren hefft, bolek[in],
dat help[e]t di nicht en kaff.
Claussen (1919) – S. 54
Woldeſtu yo min boleken wezen,
Jk wolde dick en par klyppeken gheven,
Wo behaghet dy dat?
Dat du mik en par klyppeken gheveſt
Vnde ik des dy nenen danck en wuſte,
Wat vorſlaghe di dat?
Bolekyn lat aff, Bolekyn lat aff
Yo du mer mi lacht,
Yo du mer vorloren hefft boleken,
Dat helpt di nicht en kaff.
Sprachstand
N
Mit RLB 37 liegt ein Lied vor, dessen mittelniederdeutscher Sprachstand durch überregional verbreitete und überdies durch einzelne ostfälische Kennformen geprägt ist.
Das Lied wurde zweimal in die Handschrift eingetragen, zunächst auf Blatt 29v und 30r (Fassung 37a) ohne und ein weiteres Mal auf Blatt 44r (Fassung 37b) mit Melodienotation. Beide Fassungen unterscheiden sich hinsichtlich einer Variable. Gemeint ist das Personalpronomen der 2. Singular Dativ und Akkusativ in Vers 2, das in 37a auf Akkusativ- (dick) und in 37b auf Dativbasis (di) gebildet wurde. In der Fassung a kommt - neben der mehrfach belegten Dativ basierten Variante dy 'dir' (V. 3, 5, 6, 9) - mit mik 'mich' in Vers 4 zumindest eine weitere ostf., d. h. Akkusativ basierte Variante vor. Die Form wo 'wie' (V. 3) schließlich gilt als nordnd. Kennform.
Liste der Kennformen
| 37a, V. 2 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |
| 37b, V. 2 | di | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 3 | wo | 'wie' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.3.) |
| V. 3 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 4 | mik | 'mich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |
| V. 5 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 6 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 9 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
Einspielungen
RLB 37: Woldestu yo min bolekin wezen
RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch
RLB 37: Woldestu yo min boleken wezen
Lilienthal: Rostocker Liederbuch
Parallelüberlieferung
Keine Parallelüberlieferung bekannt.
Literatur
Alpers, Paul: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Her. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuw Balzer 1919. Rostock, Hinstorff. In: Zeitschrift für deutsche Mundarten. 15. 1920. S. 186–187, hier: S. 186–187.
Alpers, Paul (Hrsg.): Die alten niederdeutschen Volkslieder. Gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben von Paul Alpers. Hamburg 1924. S. 122, 237.
Alpers, Paul (Hrsg.): Alte niederdeutsche Volkslieder mit ihren Weisen. 2. stark veränd. Aufl. Münster 1960. S. 103, 202.
Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier: S. 11.
Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 274.
Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 23.
Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VIII–IX, 54.
Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.
Glagla, Helmut (Hrsg.): Das plattdeutsche Liederbuch. 123 niederdeutsche Volkslieder von der Frührenaissance bis ins 20. Jahrhundert. 2., verbesserte Auflage. München / Zürich 1982 (= Artemis Bücher zur Musik). S. 50, 267.
Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 131–132, 454.
Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 256.
Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 51 A. 32, 54, 56 A. 40, 62–63.
Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.
Holznagel, Franz-Josef: ‚wil gi horen enen sanck?‘ Zum Konzept einer Medienkulturgeschichte der Lyrik in den handschriftlichen, weltlichen Liederbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Klein, Dorothea / Brunner, Horst / Löser, Freimut (Hrsg.): Überlieferungsgeschichte transdisziplinär. Neue Perspektiven auf ein germanistisches Forschungsparadigma. Wiesbaden 2016 (= Wissensliteratur im Mittelalter. 53). S. 307–336, hier: S. 324.
Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57, 59.
März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 143.
Petzsch, Christoph: Zur Vorgeschichte der Stammbücher. Nachschriften und Namen im Königsteiner Liederbuch. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 222. 1985. S. 273–292, hier: S. 280 A. 25.
Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–196, 198–200, 204, 210, 255–256, 286, 302, 306.
Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 476.
Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.