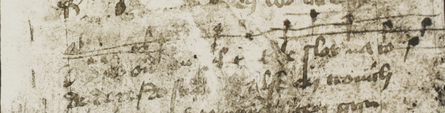"[...] nympt se vlitich war"
Textinformationen
Nummer im RLB: 33 (Claussen: 27)
Blattnummer: 27r–28r
Texttyp: Register III – Schwanklied (1.4.2)
Inhalt: Lied mit Anklang an die Tradition des Einlassliedes (Serena), in dem ein Liebhaber abends an die Tür der von ihm begehrten Dame klopft. Die Erwartungen, die der Gattungsanklang erzeugt, werden im RLB jedoch unterlaufen, indem der Mann zwar Eintritt in das Zimmer der geliebten Frau erhält, von ihr jedoch gleich wieder herauskomplimentiert wird. Nachdem es seinem Nebenbuhler genauso ergeht, hat erst ein "pape" Glück bei der Dame, der für das Treffen 20 Mark bezahlt.
Textabdruck
Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 251 [59]f.
[ . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. ] nympt ſe vlitich war.
Ik qwam to er gheghanghen
vnd boet er guden dach.
wor na ſcolde my vorlanghen?
ik wart nicht wol entfanghen.
nü horet [. . .] my ſchach.
Ik ſette my up er bedde,
ſlap was myn begher.
do begunde ſe to ſpreken,
dat er de hals to breke!
vnde ik moſte uth der doer.
"Vrowe, ik do id gherne,
wo late gy alſo?
jk do id doch mit willen.
kan [. .] nement ſtillen?
wo late gy al[ſo]?"
[. . . . . ouer . . . . . . .]
ſe ſlot na to de dore.
do ſtuont [ik] alſe en trouich man,
my was to minem herten gram.
de vroude de was [. . . . .].
Dar qwam en ander gheghanghen
ſliken by der want.
de was dar beth [. . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .]
[ . . . . . .] geſ [. . .]
[we]ſet ſtille vnd ok nicht luet.
Hir was en dere ghekomen,
hebbe gi dat nicht vor nomen?
to der dore moſt he vth.
Do ſtund ik vnd horede
vnd dachte in mynem ſyn:
de ene kumpt, de ander gheit,
vor was ik leff, nü bin ik leyt,
dat gheit dar wol by hen.
De to er nicht komen kan,
to eme gheit ſe.
Se bedencket en loghen alſo vort,
ſe ſecht ſe heuet miſſe ghehort.
dat er nummer gud en ſchee!
Se heuet ſick to enem papen gheſellet,
de louede er xx mark.
dat was nicht al ſyn rede ghelt,
id wart up enen blawen hoyken telt.
ſe heft en driuende werk.
Dar up dit leet ghedichtet is,
de het [. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. .] ſy[. . . . . . . . r]n.
Claussen (1919) – S. 48–50
[.................] nympt ſe vlitich war.
Jk quam to er gheganghen
Unde boet er guden dach,
Wor na ſcolde mi vorlanghen,
Jk wort nicht wol entfanghen,
Nu horet, wat my ſchach.
Jk ſette my up er bedde,
De ſlap was myn begher,
Do begunde ſe to ſpreken,
Dat er de hals tobreken
Unde ik moſte uth der Dör.
"Vrowe, ik do id gherne,
Wo late gy alſo,
Jk do id doch mit willen,
Kan ik id nummer ſtillen?
Wo late gy alſo?"
[...........................]
Se ſlot na to de dore,
Do ſate ik alſe en trorich man,
My was to mode ſere gram,
De vrowde de was [vorloren].
Dor quam en ander gheghangen
Unde ſliken by der nacht,
De was dor beth [entfanghen]
[......................................
.......................................
.......................................
......] ſtille unde ok nicht lut,
Hir was en deve ghekomen,
Hebbe gi dat nicht vornomen?"
To der dore moſt he uth.
Do ſtand ik unde horede
Unde dachte in mynem ſyn,
De ene kumpt, de ander gheit,
Vor wes ik leff nü bin.
Ik leyt, dat gheit dor wol by hen.
De to er nicht komen kan,
To eme (hen) gheit ſe,
Se bedencket en loghen alſo vort,
Se ſecht ſe hevet miſſe ghehort,
Dat er nummer gud en ſchen.
Se hevet ſick to enen papen gheſellet,
De lovede er vormerk,
Dat was nicht al ſyn rede ghelt,
Jd wert up enen blawen hoyken telt,
Se heft en drivende werk.
Darup dyt let ghedichtet is,
De het [......... Schluß fehlt.]
Sprachstand
N
Der Sprachstand von RLB 33 ist mittelniederdeutsch mit westniederdeutschen, elbostfälisch-südmärkischen sowie nordniederdeutschen Kennformen.
Die o-Graphie für gedehntes o in offener Tonsilbe in ouer 'über' (V. 21), ghekomen 'gekommen' (V. 33), vor nomen 'vernommen' (V. 34), komen 'kommen' (V. 41) und louede 'lobte' (V. 47) verweist auf das Ostf. und Westf. als westnd. Schreibsprachen. Im Nordnd. hatte sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts bereits die Schreibung <a> in dieser Position durchgesetzt.
Die Varianten stu(o)nt und stund 'stand' (V. 23, 36) mit u-Graphie für mnd. ô1 legen die Beeinflussung des Sprachstandes durch das Elbostf. und/oder das benachbarte Südmärk. nahe. Das Vorkommen der Variante het 'hat' (V. 52) als einer weiteren Kennform dieser Gebiete stützt diese Annahme.
Charakteristisch für das Nordnd. sind die Realisierungen der Interrogativadverbien 'wo' und 'wie' als wor (V. 8) bzw. wo (V. 17, 20). Die Form wol 'wohl' (V. 9, 40) galt sowohl im Nordnd. als auch im Ostf. Auf diese Schreibsprachenareale verweist zudem auch die Variante werk 'Werk' (V. 50) mit der typischen Senkung von er zu ar vor Konsonant (Peters 1.1.5.2.), die hier zwar nicht graphisch angezeigt wurde, jedoch aufgrund des dazugehörigen Reimwortes mark 'Mark' (V. 47) für die gesprochene Sprache anzunehmen ist.
Überregionale Gültigkeit, nämlich im Nordnd., Südm. und Westf., besaß die Form my 'mir' (V. 8, 10, 11, 24) als Variante des Personalpronomens der 1. Singular Dativ und Akkusativ auf Dativbasis.
Liste der Kennformen
| V. 8 | wor | 'wo' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.1.) |
| V. 8 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 9 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |
| V. 10 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 11 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 17 | wo | 'wie' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.3.) |
| V. 20 | wo | 'wie' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.3.) |
| V. 21 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |
| V. 23 | stu(o)nt | 'stand' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 1.3.7.) |
| V. 24 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |
| V. 33 | ghekomen | 'gekommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |
| V. 34 | vor nomen | 'vernommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |
| V. 36 | stund | 'stand' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 1.3.7.) |
| V. 40 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |
| V. 41 | komen | 'kommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |
| V. 47 | louede | 'lobte' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |
| V. 52 | het | 'hat' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 2.1.8.1.) |
Einspielungen
RLB 33: Ik qwam to er ghegangen
RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch
Parallelüberlieferung
Keine Parallelüberlieferung bekannt.
Literatur
Alpers, Paul: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Her. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuw Balzer 1919. Rostock, Hinstorff. In: Zeitschrift für deutsche Mundarten. 15. 1920. S. 186–187, hier: S. 187.
Alpers, Paul (Hrsg.): Die alten niederdeutschen Volkslieder. Gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben von Paul Alpers. Hamburg 1924. S. 90–92, 229.
Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier: S. 15.
Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 273.
Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. 48–50.
Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.
Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 130–131.
Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 255.
Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 54, 56 A. 39.
Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.
Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Zur gegenseitigen Erhellung von Text- und Melodiekritik bei der Edition des 'Rostocker Liederbuchs'. Mit einer Neuausgabe der Lieder RLB Nr. 33 und 6. In: Editio. 28. 2014. S. 82–101, hier: S. 83–89, 91, 98–99, 101.
Holznagel, Franz-Josef: Songs and Identities. Handwritten Secular Songbooks in German-Speaking Areas of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: Poel, Dieuwke van der / Grijp, Louis Peter / Anrooij, Wim van (Hrsg.): Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. Leiden, Boston 2016 (= Intersections. 43). S. 118-149, hier: S. 133.
Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.
März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 142.
Möller, Hartmut: Das Rostocker Liederbuch. Aktuelle Perspektiven der Forschung. In: Ochs, Ekkehard (Hrsg.): Studien zur lokalen und territorialen Musikgeschichte Mecklenburgs und Pommerns. Im Auftrag des Landesmusikrates Mecklenburg-Vorpommern e.V. herausgegeben von Ekkehard Ochs. II. Greifswald 2002. Bd. 2. S. 107–111, hier: S. 110.
Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195, 197–200, 202, 251–252, 285, 295, 304.
Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 477.
Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 118, 123.
Schwanholz, Wilfried: Volksliedhafte Züge im Werk Oswalds von Wolkenstein. Die Trinklieder. Frankfurt a. M. 1985 (= Germanistische Arbeiten zur Sprache und Kulturgeschichte. 6). S. 118, 165, 197, 243.
Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.